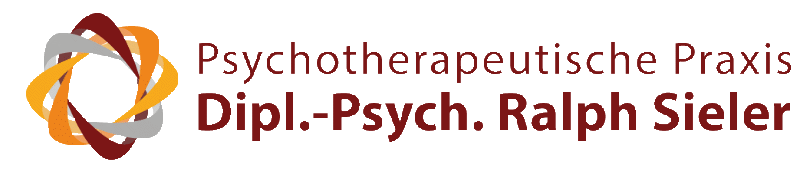Verhaltenstherapie

Verhaltenstherapie
Die Verhaltenstherapie entstand im Gegensatz zu den sogenannten psychodynamischen Verfahren (Psychoanalyse, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie), deren Theorien aus den Erfahrungen im Umgang mit Patienten abgeleitet wurden, aus der Lerntheorie.
Aus den Experimenten von I.P. Pawlow (Speichelreflex beim Hund) und B.F. Skinner (Auswahl eines Verhaltens je nach den erwarteten Konsequenzen) folgerte man, dass ähnliche Lernprozesse auch beim Menschen zu finden sein müssten. Und tatsächlich können Sie dies relativ leicht überprüfen, wenn Sie sich einen Moment Zeit nehmen und sich einmal vorstellen, wie Sie in eine saftige Zitrone beißen… Sehen Sie, der Speichelreflex funktioniert auch beim Menschen. Die klassische Verhaltenstherapie entwickelte daraus Modelle zum Beispiel der Entstehung von Angststörungen, die noch heute Anwendung finden. Die Logik der Veränderung in der klassischen Verhaltenstherapie liegt demnach in Trainingsprozessen oder in der Veränderung der Konsequenzen unseres Handelns.
Kognitive Verhaltenstherapie
Während vor allem B.F. Skinner meinte, dass Verhalten ausschließlich von erwarteten Konsequenzen bestimmt wird (alles andere sei nicht zu erfassen), entwickelte sich in den 70er Jahren der Ansatz der Kognitiven Verhaltenstherapie. Dieser geht davon aus, dass jede Situation aufgrund unserer Erfahrungen im Leben und vor dem Hintergrund unserer Einstellungen, Überzeugungen, Vorurteile und so weiter interpretiert wird. Und diese Interpretation der Realität sei schließlich entscheidend für unser Verhalten (Denken, Fühlen, Körperreaktionen und Handeln) in der jeweiligen Situation. Das jeweilige Verhalten hat dann bestimmte positive oder negative, kurz- oder langfristige Konsequenzen. Und diese bestimmen dann häufig, ob ein Mensch sich in der gleichen Situation wieder so verhält oder anders und sie bestätigen oder widerlegen unsere Einstellungen und Überzeugungen aus denen heraus wir handeln. In der Therapie müssen also vor allem unsere Bewertungen von Situationen verändert werden.
Denn:
Wir leiden nicht an dem was tatsächlich passiert, sondern an unserer Bewertung dessen!

Die (kognitive) Verhaltenstherapie ist die absolute Grundlage meiner Arbeit. Auch wenn ich sie mit der Zeit um andere Verfahren und Methoden, wie Schematherapie oder Hypnotherapie ergänze, bleibt mein therapeutisches Denkmodell doch das der Verhaltenstherapie. Ich finde dieses Modell, da es auf nachvollziehbaren theoretischen Annahmen beruht, sehr nachvollziehbar und transparent für die Patienten, die diese Art, ihre Schwierigkeiten therapeutisch zu sehen gut selbst erlernen können und so nicht auf die Deutungen des Therapeuten angewiesen bleiben. So können Patienten zum Experten ihrer eigenen „Störung“ werden, was für mich einen wünschenswerten Ansatz zur Selbsthilfe darstellt.
Schematherapie
Die Schematherapie ist eine der aktuellsten Weiterentwicklungen der Verhaltenstherapie. Es ist nämlich keineswegs immer so, wie die Kognitive Verhaltenstherapie annimmt, dass Gefühle immer durch Bewertungen von Situationen entstehen. Manchmal ist es sogar genau anders herum. Kennen Sie das Gefühl, scheinbar immer wieder in dieselben Situationen und Partner zu geraten, scheinbar egal, was Sie tun? Das Gefühl, etwas im Erwachsenenalter zu erleben, dass sich wieder genauso anfühlt, wie Sie es als Kind schon kannten? Oder auch das Gefühl, dass Sie endlich etwas Neuem begegnen, nach dem Sie sich schon lange gesehnt haben und dann fühlt es sich so völlig unpassend und nicht zu Ihnen gehörend an? Und das alte hat sich im Vergleich dazu vielleicht schlecht, aber wenigstens passend angefühlt? Dann sind Sie in Ihre Lebensfallen getappt. Die Schematherapie kann hier Erklärungen und Lösungen bieten. Sie geht davon aus, dass in Ihrer Auseinandersetzung mit ihren Entwicklungsbedingungen (Elternhaus, Schule etc.) bestimmte Ihrer Bedürfnisse erfüllt, andere nicht ausreichend erfüllt werden. In diesem Prozess bilden sich sogenannte Schemata heraus, Verbindungen von Denken und Fühlen. Zum Beispiel könnte man davon überzeigt sein, dass man den Ansprüchen anderer nie genügt (Schema „Unzulänglichkeit“) oder man hat erfahren, dass wichtige Bezugspersonen einen immer wieder verlassen oder sich nicht um einen kümmern (Schema „Im Stich gelassen“). In dieser Entwicklung bilden sich auch Überzeugungen über einen selbst heraus und ein Gefühl, was zu einem „gehört“ und was nicht. Häufig zeigen sich diese Schemata in der Partnerwahl. Und so ist es dann auch erklärbar, warum zum Beispiel manche Frauen immer wieder an saufende prügelnde Männer geraten. Die Schematherapie bietet hier Ansätze, Ihre Muster zu erkennen, zu verstehen und auch zu verändern!
Aber auch die Schematherapie selbst entwickelt sich weiter und hat inzwischen mit dem sogenannten Modusmodell eine Erweiterung des oben skizzierten Schemamodells vorgelegt. Hier geht man davon aus, dass wir uns häufig in bestimmten Funktionsmodi befinden, in denen mehrere Schemata zum Ausdruck kommen. Die Modi sind sozusagen das, was man von den im Hintergrund aktiven Schemata nach außen im Verhalten wahrnehmen kann. Man unterscheidet grob Kindheit-, Eltern-, Erwachsenen- und Bewältigungsmodi. Deren oft komplexe Interaktionen können vor allem mittels Stühlearbeit wirkungsvoll „auseinandergesetzt“ und verändert werden, erfahren verletzte Kindanteile Trost und werden „Innere Eltern“ entmachtet.